Ich habe einen Freund – nennen wir ihn Tom – der wie ich Schriftsteller ist. Tom hat im Laufe einer langen und beneidenswerten Verlagskarriere viele Romane geschrieben, und seine Philosophie des Romanschreibens, die er mir bei verschiedenen Drinks in verschiedenen Bars erzählte, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Schreib, was immer du schreibst, welches Konzept, welche Figur oder welche Situation dir unter die Haut gegangen ist und befreit werden muss. Vergiss den Kommerz und vergiss das Publikum – du schreibst für ein einziges Publikum, und wenn ein Redakteur oder Leser es interessant findet, umso besser. Ein Bestseller sollte nach Toms Ansicht lediglich eine glückliche Übereinstimmung der Interessen der Welt mit den eigenen sein, eine momentane Besetzung eines dominanten Paradigmas, das im Grunde genommen nicht planbar ist. Oder zumindest nicht planbar.
Toms Philosophie hat viele Vorteile. Sie ist rein, kompromisslos und kompromisslos. Sie führt vermutlich zur besten Kunst, zumindest wenn man davon ausgeht, dass die abenteuerlichste Kunst in der Regel am wenigsten auf Geld Rücksicht nimmt. Und sie ist auch leicht zu befolgen, indem man sich einfach an ihr einziges thelemisches Gebot hält: Tu, was du willst.
Es ist schließlich eine beruhigende künstlerische Position, die ein Künstler gegenüber dem Kommerz einnehmen kann. Wenn man seinen künstlerischen Impulsen ganz und gar verpflichtet ist, kann es einen nicht überraschen oder stören, wenn sich ein Kunstwerk nicht verkauft. Sie haben es nicht geschaffen, um es zu verkaufen. Wenn es sich verkauft, ist das großartig, aber ob es sich verkauft oder nicht, ist eine reine Glückssache, ein Glücksrad. Darüber hinaus impliziert es einen rückwirkend freisprechenden Determinismus – wenn ein Leben lang künstlerische Arbeit keine Gemälde, keine Alben, keine Bücher verkauft hat, warum sich dann aufregen? Schließlich hätte man immer das getan, was man tun wollte, und man hätte nie das getan, was man nicht tun wollte, und das, was man getan hat, wäre nie unpopulär gewesen, QED.
Das mag eine philosophisch solide Position sein, aber ist sie auch unbedingt wahr? Ich begann, mir diese Frage nach der Veröffentlichung und dem Nichterfolg – dem Anti-Erfolg – meines ersten Romans zu stellen. Ich schrieb das Buch, wie viele Erstlingsautoren, in einer Art prälapsarischer Unschuld, geschützt vor den praktischen Sorgen der Veröffentlichung durch Unwissenheit und Verwunderung über die seltsame Tatsache, überhaupt einen Roman zu schreiben. Am Anfang hatte ich nicht einmal wirklich vor, einen Roman zu schreiben, ich hatte einfach an einer Kurzgeschichte gearbeitet, die immer mehr Seiten anhäufte. Am Ende wurde sie an einen Verlag verkauft, und die ganze Erfahrung hatte die verschwommene Qualität eines Traums, ein Eindruck, der durch die geheimnisvolle Undurchschaubarkeit des Verlagsprozesses noch verstärkt wurde.
Als ich mich auf einen zweiten Roman vorbereitete, hatte ich keine solchen Illusionen. Ich hatte gesehen, welche Maschinerie zur Herstellung eines Buches erforderlich ist, all die hartnäckigen Handelsmaschinen, die zum Leben erweckt werden müssen; ich hatte die fernen Veröffentlichungszeitpläne erhalten, die wichtigen Termine, die sich fast zwei Jahre in der Zukunft anfühlen; und vor allem hatte ich ein Buch herausgebracht, das außer ein paar guten Kritiken nicht viel gebracht hat. Das sind Lektionen, die man nicht verlernen kann, und sie bringen eine gewisse Vorsicht bei den Projekten mit sich, denen man seine Zeit und Aufmerksamkeit widmen will. Plötzlich schlichen sich viele marktbezogene Überlegungen ein, die mir beim ersten Mal nie in den Sinn gekommen wären. Ich begann mich zu fragen, contra Tom: Kann ein Schriftsteller ein populäres Buch schreiben?

 In einem weitgehend scherzhaften (wenn auch etwas ernsthafteren, als ich zugeben möchte) Versuch, diese Frage zu klären, beschloss ich, den wörtlichsten möglichen Ansatz zu wählen und mehrere Jahre lang die Bestsellerlisten der New York Times durchzugehen. Um einen Bestseller zu schreiben, wäre es schließlich hilfreich zu wissen, was sich am besten verkauft hat. Die Times-Bestsellerliste mag wie ein weites Netz erscheinen, aber wenn ich nur die literarischen Spitzenreiter zähle, bleiben mir ungefähr All the Light We Cannot See und The Nightingale. Also dachte ich mir, dass es reichen würde, eine Woche lang die Top Ten zu erreichen, und zwar in den letzten fünf Jahren. Wenn man zu weit zurückgeht, könnte man auf epochale Geschmacksveränderungen stoßen, auf eine vergessene Manie in den achtziger Jahren. Außerdem fehlte mir die Zeit.
In einem weitgehend scherzhaften (wenn auch etwas ernsthafteren, als ich zugeben möchte) Versuch, diese Frage zu klären, beschloss ich, den wörtlichsten möglichen Ansatz zu wählen und mehrere Jahre lang die Bestsellerlisten der New York Times durchzugehen. Um einen Bestseller zu schreiben, wäre es schließlich hilfreich zu wissen, was sich am besten verkauft hat. Die Times-Bestsellerliste mag wie ein weites Netz erscheinen, aber wenn ich nur die literarischen Spitzenreiter zähle, bleiben mir ungefähr All the Light We Cannot See und The Nightingale. Also dachte ich mir, dass es reichen würde, eine Woche lang die Top Ten zu erreichen, und zwar in den letzten fünf Jahren. Wenn man zu weit zurückgeht, könnte man auf epochale Geschmacksveränderungen stoßen, auf eine vergessene Manie in den achtziger Jahren. Außerdem fehlte mir die Zeit.
 Ein unmittelbares Problem, das sich bei dieser Übung stellte und das den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, war die Frage, was als „literarische Fiktion“ gilt. Für meine Zwecke schloss ich fast alles ein, was nicht mit weltweiten Verschwörungen, Serienmördern, Werwölfen und Gestaltwandlern und schurkischen Dreifachagenten zu tun hat – also alles, was nicht offensichtlich dem Genre zuzuordnen ist. Und obwohl sie sich auf den Barden von Avon berufen, hat William Shakespeares Star-Wars-Reihe – Das Imperium schlägt zurück, Die Rückkehr der Jedi kehrt zurück, ich erfinde das nicht – es nicht in die Endauswahl geschafft.
Ein unmittelbares Problem, das sich bei dieser Übung stellte und das den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, war die Frage, was als „literarische Fiktion“ gilt. Für meine Zwecke schloss ich fast alles ein, was nicht mit weltweiten Verschwörungen, Serienmördern, Werwölfen und Gestaltwandlern und schurkischen Dreifachagenten zu tun hat – also alles, was nicht offensichtlich dem Genre zuzuordnen ist. Und obwohl sie sich auf den Barden von Avon berufen, hat William Shakespeares Star-Wars-Reihe – Das Imperium schlägt zurück, Die Rückkehr der Jedi kehrt zurück, ich erfinde das nicht – es nicht in die Endauswahl geschafft.
(Bevor ich zu den eigentlichen Ergebnissen komme, ein paar Anmerkungen, nachdem ich viele Arbeitsstunden damit verbracht habe, fast 300 dieser wöchentlichen Listen durchzugehen. Erstens – und mir ist klar, dass dies der Gipfel der abgedroschenen Verlagsbeobachtung ist – aber verdammt noch mal, James Patterson oder der militärisch-industrielle Komplex von James Patterson oder was auch immer es ist, produziert eine Menge Bücher. Ich bin mir nicht sicher, ob mir in den letzten fünf Jahren mehr als eine Handvoll Wochen aufgefallen sind, in denen nicht irgendeine Patterson-Permutation auf der Liste stand. David Baldacci ebenfalls. Zweitens ist Brad Thor vielleicht der einzige Bestsellerautor des Genres, der einen weniger plausiblen Namen hat als sein Protagonist, den relativ banalen „Scott Horvath“. Man sollte meinen, sein Held sollte so etwas wie Odin Hercules heißen, aber nein.)

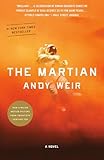


 Was habe ich aus der langen Liste der jüngsten literarischen Hits gelernt? Nun, zum einen sollte man seinen Titel mit „The“ beginnen. Etwa ein Drittel dieser Bestseller sind „The“-Bücher. Der Stieglitz, Die Nachtigall, Der Marsmensch, Die Zinsen, Die Urlauber, Das Mädchen im Zug. Zugegeben, „the“ ist ein recht gebräuchliches Wort im englischen Sprachgebrauch, aber ich vermute, dass es auch eine gewisse unterschwellige Wirkung auf potenzielle Leser hat, da es ein Buch als offizielles Thema und Ziel ankündigt – der definitive Artikel sozusagen. Stellen Sie sich nur vor, wie viele Exemplare von All the Light We Cannot See verkauft worden wären, wenn es zum Beispiel den Titel The Light We Cannot See (All of It) oder The Entirety of Unseen Light getragen hätte.
Was habe ich aus der langen Liste der jüngsten literarischen Hits gelernt? Nun, zum einen sollte man seinen Titel mit „The“ beginnen. Etwa ein Drittel dieser Bestseller sind „The“-Bücher. Der Stieglitz, Die Nachtigall, Der Marsmensch, Die Zinsen, Die Urlauber, Das Mädchen im Zug. Zugegeben, „the“ ist ein recht gebräuchliches Wort im englischen Sprachgebrauch, aber ich vermute, dass es auch eine gewisse unterschwellige Wirkung auf potenzielle Leser hat, da es ein Buch als offizielles Thema und Ziel ankündigt – der definitive Artikel sozusagen. Stellen Sie sich nur vor, wie viele Exemplare von All the Light We Cannot See verkauft worden wären, wenn es zum Beispiel den Titel The Light We Cannot See (All of It) oder The Entirety of Unseen Light getragen hätte.
 Ein weiterer kluger Schachzug ist es, bereits berühmt zu sein. Idealerweise sollte man To Kill a Mockingbird vor 50 Jahren geschrieben haben, aber ansonsten sollte man zumindest eine bekannte Größe sein. Damit ergibt sich natürlich ein weiteres Henne-Ei-Problem, nämlich die Frage, wie diese Autoren zu bekannten Größen wurden, bevor sie es waren. Auf jeden Fall scheinen überraschend wenige Autoren aus dem Nichts auf die Liste zu kommen.
Ein weiterer kluger Schachzug ist es, bereits berühmt zu sein. Idealerweise sollte man To Kill a Mockingbird vor 50 Jahren geschrieben haben, aber ansonsten sollte man zumindest eine bekannte Größe sein. Damit ergibt sich natürlich ein weiteres Henne-Ei-Problem, nämlich die Frage, wie diese Autoren zu bekannten Größen wurden, bevor sie es waren. Auf jeden Fall scheinen überraschend wenige Autoren aus dem Nichts auf die Liste zu kommen.
Ernsthafter: Schreiben Sie eine von zwei Arten von Büchern: Krimis oder historische Romane, wenn möglich beide. In beiden Genres sind Sie in guter Form, wenn Sie etwas einbauen können, das mit einem berühmten Gemälde oder Maler oder einem anderen bemerkenswerten Kunstwerk oder Künstler zu tun hat. Auch alles, was mit Heirat und Reisen zu exotischen Orten zu tun hat. Immer wieder tauchte eine Kombination dieser Elemente auf, und das offensichtliche gemeinsame Thema ist die Flucht: die Flucht in die Vergangenheit, die Flucht in ein Geheimnis, die Flucht in Ästhetik und Kultur, die Flucht in imaginäre Beziehungen und die buchstäbliche Flucht aus der Heimat in unbekannte Gebiete. Es stellt sich heraus, dass der Fluchtinstinkt, der den Verkauf von Genreliteratur ankurbelt, auch bei den Lesern literarischer Werke lebendig ist – er erfordert lediglich (fraglich) bessere Sätze und (in der Regel) weniger phantastische Ausschmückungen.
Mit diesen Leitlinien im Hinterkopf habe ich mir ein paar potenzielle Romane ausgedacht, die auf der Liste nicht fehl am Platz gewesen wären. Hier ist einer: ein historischer Krimi, der auf dem Leben und Tod von Paul Gauguin basiert. Er wird jedoch aus der Perspektive seiner entfremdeten Frau Mette-Sophie erzählt, die ein Tagebuch führt, während sie die Welt bereist und das künstlerisch triumphale und moralisch bankrotte Leben ihres Mannes untersucht, nachdem er seine Familie verlassen hat. Nennen Sie es Die Tagebücher der ersten Frau Gauguin. Eine Zusammenfassung dieses gespenstischen Buches im Stil der Agentenanfragen lautet wie folgt:
Als ein bisher unbekanntes Gemälde von Paul Gauguin in einer verlassenen Wohnung in Chicago entdeckt wird, erhält die Kunsthistorikerin Lena Wexler den Auftrag, die Herkunft des Gemäldes ausfindig zu machen; eine Untersuchung durch Zeit und Ort – von Chicago bis Miami, von Dänemark bis Frankreich, von Tahiti bis zu den Marquesas, alles mit Hilfe der Tagebücher der ersten Mrs. Gauguin. Gauguin.
Hört sich das nach einem Buch an, das man kaufen würde? Ich denke schon. Ich kann mir dieses Buch sehr gut auf dem Couchtisch meiner Schwiegermutter vorstellen, einer alles verschlingenden Leserin von literarischen Bestsellern, Klassikern und Sachbüchern, die einen monatlichen Buchclub leitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ich 20 Agenten mit diesem Exposé anschreiben würde, ein oder zwei um ein Exemplar bitten würden. Es klingt wie ein beliebtes Buch.
Das einzige Problem ist, dass ich es schreiben müsste, damit es existiert. Und das ist kein Buch, das ich schreiben kann. Dieses kleine Gedankenexperiment bestätigte mir, was ich bereits wusste, dass man für das Schreiben eines Romans einen unaussprechlichen, persönlichen Funken des Interesses braucht, der Feuer fängt und beständig genug brennt, um nicht von Zweifeln und kreativem Unvermögen ausgelöscht zu werden; ein Feuer, das sich mit der Zeit als Neugierde auf das Thema und das Projekt selbst manifestiert, darauf, wie sich alles entwickelt. Fehlt dieses tiefe Interesse, bleibt ein ansonsten gültiges Projekt – spannend, interessant und kommerziell – eine theoretisch gute Idee, wie ein Medizinstudium oder der Ausstieg aus den sozialen Medien.
Seit der Entstehung dieses Essays habe ich einen weiteren Roman veröffentlicht und zwei weitere in der Überarbeitung, und ich habe Toms Standpunkt voll akzeptiert: Man muss schreiben, was man schreiben will, auch wenn das, was man schreiben will, normalerweise nicht das ist, was die Leute lesen wollen. Man kann nicht zwei bis fünf Jahre für eine theoretische, externe Belohnung an etwas arbeiten. Ich kann es jedenfalls nicht, aber vielleicht können es andere – wenn dem so ist, dann gehört The Journals of the First Mrs. Gauguin ganz Ihnen.
Bild: Flickr/Nabeel H